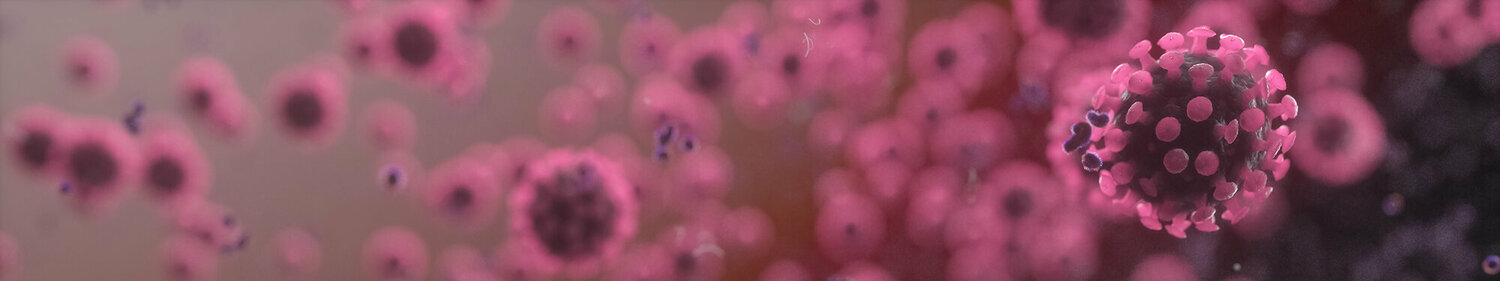
Psychotherapeutische Versorgung und COVID-19: Informationen für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
Was ist in der psychotherapeutischen Versorgung im Kontext von COVID-19 wichtig? Im Folgenden haben wir zentrale Informationen und Links zu diesem Themenfeld zusammengefasst.
- Wo finden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten allgemeine berufsbezogene Informationen im Zusammenhang mit COVID-19?
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sich zu berufsrelevanten Regelungen im Zusammenhang mit COVID-19 erkundigen möchten, können die Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) [externer Link] und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) [externer Link] nutzen. Bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kann eine Bilanz zur ambulanten Versorgung in der Corona-Pandemie [externer Link] abgerufen werden.
Informationen über die Regelungen zur Erbringung von Fortbildungsnachweisen für Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten und zur Umsetzung der Fortbildungspflicht im Zusammenhang mit der COVID-19-Situation durch die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen haben wir in der Rubrik Fortbildung zusammengestellt.
Angestellt tätige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten finden auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) [externer Link] Informationen zu Arbeitsschutz und sozialer Absicherung.
Einen Überblick über die Forschungslage bietet die Publikation „Corona-Pandemie und psychische Erkrankungen" [PDF, 502 KB] der Bundespsychotherapeutenkammer.
Fachinformationen rund um COVID-19 bündelt das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner COVID-19-Internetseite [externer Link].
Informationen für Patientinnen und Patienten erhalten Sie auf unserer Homepage unter: Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung. - Was gilt hinsichtlich COVID-19-Schutzimpfungen?
Aktuelle Hinweise zur Durchführung der Schutzimpfungen bietet die Sonderseite zur Corona-Schutzimpfung in Nordrhein-Westfalen [externer Link] des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums (MAGS NRW). Auf der Website des Bundesgesundheitsministerium (BMG) finden sich Fragen und Antworten zur COVID-19-Impfung [externer Link]. Auch informieren das Robert Koch-Institut (RKI) [externer Link] und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) [externer Link] informiert zur COVID-19-Impfung.
- Wo finden sich Informationen zur Hygiene in der psychotherapeutischen Praxis?
Eine umfassende Informationsquelle für ambulant tätige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist der allgemein gültige Leitfaden „Hygiene in der psychotherapeutischen Praxis“ [PDF-Dokument, 1.5 MB], herausgegeben vom Kompetenzzentrum Hygiene- und Medizinprodukte der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die in ihrer Praxis Hygienehinweise für Patientinnen und Patienten auslegen möchten, können das “Merkblatt Virusinfektionen – Hygiene schützt!” [PDF-Dokument, 624 KB] vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und der BZgA nutzen. Über die Corona-Übersichtsseite der BZgA [externer Link] gelangen sie zu weiteren Hygienetipps, darunter Printmedien und Plakate zu Hygienemaßnahmen für Kinder und Erwachsene. Informationen zum Coronavirus in leichter Sprache und in Gebärdensprache [externer Link] bietet das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium. - Was gilt hinsichtlich der Melde- und Schweigepflicht für psychotherapeutische Praxen?
Die Meldepflicht richtet sich für Kammerangehörige nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes [externer Link]. Die maßgeblichen Bestimmungen lauten:
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 t):
(1) Namentlich ist zu melden:1. der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod in Bezug auf die folgenden Krankheiten:
t) Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
§ 7 Absatz 1 Nr. 44a.):
(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen:44a.) Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) und Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
§ 8 Absatz 1 Nummer 5 Infektionsschutzgesetz:
(1) Zur Meldung sind verpflichtet:
...
5. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 [externer Link] Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung oder Anerkennung erfordert,§ 8 Absatz 2 Satz 2 Infektionsschutzgesetz:
Die Meldepflicht besteht für die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde.
Konkret bedeutet das: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind zur Meldung nur verpflichtet, wenn 1. ein begründeter Verdacht besteht und 2. kein Arzt hinzugezogen wurde.Auf der Website des Robert Koch-Instituts können Sie über die Eingabe von Ort oder Postleitzahl die Kontaktdaten des zuständigen Gesundheitsamts suchen [externer Link].
Aus Sicht der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen besteht aufgrund der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten keine Pflicht, Patientinnen und Patienten aktiv auf den Verdacht einer COVID-19-Erkrankung hin zu befragen oder gar zu untersuchen. Dies bleibt Ärztinnen und Ärzten überlassen. Gleichwohl ist denkbar, dass im Kontakt mit Patientinnen und Patienten – sei es persönlich oder auch telefonisch – die Sprache auf Beschwerden gerichtet wird oder die Frage nach einer möglichen Erkrankung aufkommt.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können sich hierbei an den eher allgemein gehaltenen Informationen orientieren, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter Infektionsschutz.de [externer Link] veröffentlicht hat.
Sollten im Kontakt mit Patientinnen und Patienten mit COVID-19 in Zusammenhang gebrachte Symptome und Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 berichtet werden, ist zu klären, ob die Person bereits eine Ärztin oder einen Arzt hinzugezogen hat. Ist dies erfolgt, entsteht kein weiterer Handlungsbedarf.
Sollte die ärztliche Abklärung nicht erfolgt sein oder abgelehnt werden, besteht aus Sicht der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen eine Meldepflicht. Falls eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen muss, ist dies kein Bruch der Schweigepflicht: Da es sich hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, steht die Schweigepflicht nicht entgegen. Der Patientin bzw. dem Patienten ist dies aber gemäß § 8 Absatz 3 der Berufsordnung mitzuteilen („Ist die Schweigepflicht aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift eingeschränkt, so ist die betroffene Person darüber zu unterrichten.“).
Wenn das Gesundheitsamt Sie selbst als Kontaktperson einer mit COVID-19 infizierten Person identifiziert hat, sind Sie zur Auskunft über alle Ihre Kontaktpersonen verpflichtet. In Bezug auf Patientinnen und Patienten bedenken Sie bitte, dass es im Regelfall nicht erforderlich sein dürfte, auch die Tatsache einer Behandlung gegenüber dem Gesundheitsamt zu offenbaren.
Was Sie im Falle einer eigenen Infektion mit COVID-19 zu berücksichtigen haben, entnehmen Sie bitte dem Eintrag „Was ist bei einer COVID-19-Infektion der Nutzung von Schnelltests in der Praxis zu beachten?“
- Was ist bei einer eigenen COVID-19-Infektion und der Nutzung von Schnelltests in der Praxis zu beachten?
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen empfiehlt, sich bei einem positiven Coronaselbsttest weiterhin an die AHA-Verhaltensregeln – Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten und im Alltag eine Maske tragen – zu halten und den Kontakt zu anderen Personen zu vermeiden.
Im Falle einer Infektion mit COVID-19 sind Sie nach §§ 25 Abs. 2, 16 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz zur Mitwirkung und zur Unterstützung des Gesundheitsamtes an den Ermittlungen zur Infektionskette verpflichtet, ungeachtet der Schweigepflicht gegenüber Ihren Patientinnen und Patienten.
Ansprüche auf kostenlose präventive COVID-19-Testungen mit Antigen-Schnelltests für das Personal in psychotherapeutischen Praxen bestehen bereits seit dem 1. März 2023 nicht mehr.
